Lokales Engagement: Konkret, widerspenstig und belohnend
Es wird zunehmend deutlicher, dass wir alle als Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik, derzeit unterschiedliche aber gleichzeitig wirkende Krisenphänomen erleben, die sich also überlagern, verkeilen und verstärken. Zentral dabei ist etwa die Krise des Klimas als Überhitzung der Welt und die Krise der Demokratie als Verlust des Vertrauens in die Institutionen der öffentlichen Sache. Die Mehrdimensionalität dieser Phänomene, die fast immer komplex miteinander verwoben sind, lässt einen ratlos und erschöpft zurück.
In dieser Rubrik wird besprochen, wie und ob ein lokaler Aktivismus gegen diese Krisenphänomene und die psychologischen Folgen etwas ausrichten kann.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Community Organizing: Das Konzept von Saul Alinsky
Montag, 16. Oktober 2023 | Lesezeit: | Tags: |
Community Organizing: Das Konzept von Saul Alinsky und mögliche Formen der Umsetzung im Rahmen eines Stadtteilmanagements

Ute Fischer und Lothar Stock
„CO wurde Ende der 1930er Jahre in den USA von Saul D. Alinsky (Saul David Alinsky, 1909-1972) entwickelt. Er selbst war Sohn einer jüdisch-orthodoxen Einwandererfamilie aus Weißrussland und wuchs mit seinen Eltern in einem der schlimmsten Slums von Chicago auf. Die jüdische Gemeinde bildete hier quasi ein weiteres, ein ethnisches Ghetto im ohnehin manifesten geografischen. Mittels eines Stipendiums studierte Alinsky an der University of Chicago zunächst Soziologie, dann Kriminologie. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er in einem Jugendgefängnis mit delinquenten Jugendlichen. Schnell erkannte Alinsky, dass die Arbeit dort mit dem Ziel der Resozialisierung der Inhaftierten einen unzureichenden, reaktiven Ansatz auf der individuellen Verhaltensebene darstellt. Stattdessen musste seiner Meinung nach an der nachhaltigen Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Armuts- quartieren angesetzt werden, um delinquentes Verhalten erst gar nicht entstehen zu lassen. Motor derartiger Veränderungsprozesse konnten nach Ansicht Alinskys allein die organisierten Bewohner*innen der Quartiere selbst im gemeinsamen Handeln sein.“
Artikel ist Open Access zu Herunterladen
Was ist CO?
Community Organizing (CO) wurde Ende der 1930er Jahre in den USA maßgeblich von Saul D. Alinsky entwickelt. Dieser stand wohlfahrtsstaatlichen Bemühungen generell und dem von Jane Addams im Rahmen der Settlement-Bewegung in Chicago initiierten Hull House im Besonderen deutlich reserviert gegenüber. Auch in bester Absicht ausgeübte Fürsorge verhindere seiner Meinung nach die Emanzipation der jeweils angesprochenen Adressat*innen und ändere erst recht nichts an den bestehenden Machtverhältnissen.
Alinsky wurde durch seine Projekte in den Stadtteilen von Chicago Back of the Yards und Woodlawn berühmt, in denen er Bürgerforen aufbaute, damit die Infrastruktur verbesserte und die später im ganzen Land berühmt wurden. Er schrieb zwei Bestseller »Reveille for Radicals« (1946) und »Rules for Radicals« (1970), die sein Vermächtnis der politischen Erwachsenenbildung darstellen. »Radikal sein«, meint, »die Dinge bei der Wurzel fassen«.
Literatur:
Handbuch Community Organizing – Theorie und Praxis in Deutschland
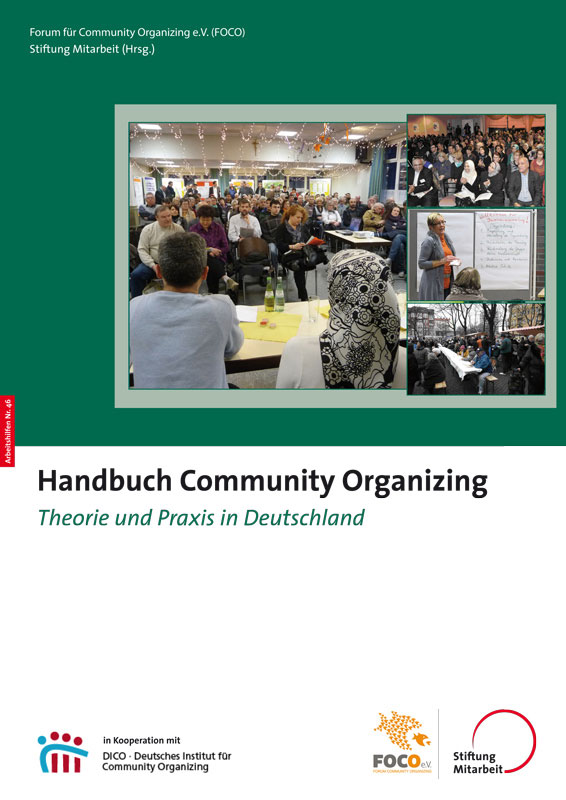
Die Stiftung Mitarbeit schreibt dazu: „Community Organizing ist Organisationsarbeit in Stadtteilen, Städten oder Regionen. Durch den Aufbau einer Beziehungskultur und durch gemeinsames Handeln tragen Bürgerinnen und Bürger zur Lösung von Problemen in ihrem Umfeld bei. Community Organizing ist dabei stets den Prinzipien von Demokratie und Selbstbestimmung verpflichtet. Das Handbuch Community Organizing, das vom Forum für Community Organizing (FOCO) und der Stiftung Mitarbeit herausgegeben wird und in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Community Organizing (DICO) erarbeitet wurde, stellt das demokratische und aktivierende Potential der Methode vor.“
Handbuch Community Organizing – Theorie und Praxis in Deutschland
Forum für Community Organizing e.V. FOCO · Stiftung Mitarbeit (Hrsg.) in Kooperation mit DICO
Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 46 | Verlag Stiftung Mitarbeit · Bonn · 2014 | 2. Auflage · 248 S. · ISBN 978-3-941143-15-9 Hier für € 12,- zu bestellen


